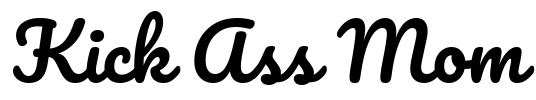Um das Ausmaß der täglichen Herausforderungen einer Mutter im 21. Jahrhundert besser zu verstehen, lohnt sich ein Blick in die Vergangenheit. Die hohe Belastung durch Job und Kleinfamilie lassen nämlich den Eindruck entstehen, dass es früher einfacher war. Damals, als Trennung von Erwerbsarbeit und Hausarbeit bzw. Familie in der breiten Bevölkerung Anklang fand und aus existenzieller Sicht möglich war. Das Bild der Hausfrau hat sich in vielen Köpfen zementiert. Denn womöglich war die eigene Mutter und sehr wahrscheinlich die eigene Großmutter nach der Familiengründung nicht mehr berufstätig. Doch wie war es früher wirklich? Welche Vorteile und Nachteile waren mit den damals gelebten Modellen verbunden? Wir sehen es uns an.
Bis vor wenigen Jahren ging die Menschheit davon aus, dass es bereits in der Steinzeit eine Art Rollenverteilung gab. Doch neuere Forschungen führen zu der Erkenntnis, dass Frauen damals nicht wie gedacht mit ihren Kindern in der Höhle blieben und Beeren sammelten, während die Männer auf Jagd gingen. Eine derartige Aufgabenverteilung fand nicht statt. Funde von Skeletten und Höhlenmalereien deuten darauf hin, dass sich beide Geschlechter die Arbeiten teilten bzw. Aufgaben geschlechtsunabhängig waren, was sich u.a. dadurch vermuten lässt, dass ein Großteil der Höhlenmalereien, die Jagdsituationen zeigten, durch Frauen entstanden. Wie hätten sie diese Situation aufgreifen können, wenn sie es nicht selbst erlebt haben?
Etwa 12.000 Jahre vor unserer Zeit wurden die Menschen sesshaft. Um ihre Besitztümer zu schützen, kam es erstmals zu einer Aufgabenteilung, die das “schwache Geschlecht” alias die Frau in die Rolle der Hausfrau und Mutter drängte, während die Männer, als köperlich Stärkere, ihre Besitztümer in Kriegen verteidigten. Dennoch war die Frau auch weiterhin auf dem Lande tätig und übernahm auch körperlich anstrengende Arbeiten, sodass sie keineswegs dem Bild der typischen Hausfrau entsprach, das wir heute vor Augen haben.
Machen wir einen Zeitsprung ins Mittelalter und betrachten eine typische Bauersfrau. Auch sie arbeitete ebenso hart wie ein Mann und bekam darüber hinaus durchschnittlich fünf bis sechs Kinder. Ein ähnliches Szenario war Gang und Gebe im späten Mittelalter sowie in der beginnenden Neuzeit vor dem 17. Jahrhundert ab. Nicht adelige Frauen waren damals weitestgehend berufstätig. Keine Frage, die Frauen und Mütter standen zu dieser Zeit größten, meist existenziellen Herausforderungen gegenüber. Doch dürfen wir eines nicht vergessen: Ihre Kinder mussten sie zwar gebären und vielleicht für eine Weile stillen, doch “Erziehungs- und Betreuungsarbeit”, wie wir sie heute kennen, existierte nicht. Auf dem Land wurden Kinder nicht selten bis zu ihrem 6. oder 7. Lebensjahr sich selbst überlassen. Die Arbeit im Haushalt oder auf dem Bauernhof lasteten die Frauen aus, sodass kaum Zeit für die Bedürfnisse ihrer Kinder blieb. Ältere Kinder wurden als Handlanger bzw. Arbeitskräfte eingesetzt. Gehorchten sie nicht oder erfüllten sie keinen wirtschaftlichen Nutzen, wurden sie gezüchtigt. Ausbildung und Drill wurden nicht von der Mutter, sondern vom Vater oder einem Dienstherren übernommen.
Ähnlich war es zu Zeiten der Industrialisierung Anfang des 20. Jahrhunderts in der damals neu entstandenen Arbeiterklasse. Aufgrund des geringen Einkommens der Väter mussten auch Mütter einer Arbeit nachgehen. Bei Arbeitszeiten von 12 bis 14 Stunden am Tag und teilweise langen Wegstrecken zum Arbeitsplatz blieb kaum Zeit für eine Betreuung oder Erziehung der Kinder. Es wurde aber zugleich auch nicht gesellschaftlich erwartet. Junge Kinder orientierten sich an älteren Geschwistern oder anderen Personen in ihrer Umgebung, bis sie selbst in der Lage waren zu arbeiten. Das Perfide: Gerade verheiratete Frauen galten zu dieser Zeit als sehr begehrte Arbeitskräfte. Denn sie mussten sich wesentlich mehr bieten lassen und konnten leichter ausgebeutet werden als Männer oder unverheiratete Frauen, da sie auf den Arbeitsplatz angewiesen waren, um die Existenz der Familie zu sichern.
Bei adeligen und großbürgerlichen Familien unterschied sich zwar der Alltag deutlich von dem der Arbeiterklasse, es sah in Bezug auf die Kindererziehung durch die leiblichen Eltern jedoch kaum anders aus. Hier wurde der Nachwuchs zwar umsorgt und erzogen, doch waren es Ammen, Gouvernanten und Hauslehrer, die einen Großteil der Aufgaben übernahmen, die heute von der Mutter erwartet werden.
Es zeigt sich also, dass die Mutter bis zu dieser Zeit in unserer Kultur für ihre Kinder keine größere Rolle spielte und auch die Erziehung eher stiefmütterlich behandelt wurde. Das Phänomen der Hausfrau, die keinem Beruf nachgeht und ihre Zeit ausschließlich Haus und Familie widmet, ist in der Geschichte in Wahrheit noch relativ neu. Die Trennung von Familie und Erwerbstätigkeit erfolgte erst im späten 19. Jahrhundert mit wachsendem Wohlstand und der Entstehung des Bürgertums. Damals entstand das bürgerliche Mutterbild, demzufolge Mutterschaft eine Lebenserfüllung ist, die Frauen tiefe Befriedigung verleiht. Eine Erwerbstätigkeit neben der Rolle als Hausfrau und Mutter war für sie, sofern finanziell möglich, nicht mehr angedacht. Mütter wurden im neuen Leitbild als von Natur aus fürsorglich, selbstlos und familienorientiert beschrieben. Im Gegensatz zu den vorangegangenen Jahrhunderten war es selbstverständlich, dass sie sich intensiv um ihre Kinder kümmerten und ihre Entwicklung in allen Bereichen konsequent und kontinuierlich förderten. Obgleich zu dieser Zeit moderne und traditionelle Familientypen nebeneinander existierten, setzte sich die moderne Familie früher oder später in allen sozialen Schichten durch. Wohlhabende und gebildete Eltern begannen die Zahl ihrer Kinder rasant zu verringern. Die Mittelschicht folgte ihrem Beispiel nur kurze Zeit darauf. Erstmals profitierten ihre Kinder von einer richtigen Erziehung und Ausbildung. Lediglich Eltern in schlechten ökonomischen Verhältnissen hielten an ihrer Kinderschar und dem traditionellen Umgang mit ihnen fest. Ein Beschränken der Kinderzahl konnte erst in Betracht gezogen werden, wenn Kinder nicht mehr als zusätzliche Verdiener von Nöten waren. Für Eltern der Arbeiterklasse war dies aber lange der Fall. Familie stellte für sie in erster Linie eine Wohn- und Essensgemeinschaft in einem entbehrungsreichen Leben dar. Erst als die Kinderarbeit gesetzlich abgeschafft wurde, verringerte sich auch in Arbeiterfamilien die Kinderzahl deutlich, da sie nun einen zusätzlichen Kostenfaktor darstellen, dem kein wirtschaftlicher Nutzen gegenüberstand.
In den 1920er Jahren galt es, insbesondere im Bürgertum, als höchstes Ziel einer Frau Kinder zu gebären. Vor allem Söhne waren als Stammhalter erwünscht. In den oberen Schichten waren nun aber auch emanzipierte Frauen auf dem Vormarsch. Sie verfolgten ihre eigenen Interessen, tanzten, tranken und verhüteten. Sie definierten sich nicht mehr über das Mutterwerden, sondern über ihren Intellekt, ihre Sexualität, ihren Erfolg und unterschieden sich damit kaum von der heutigen Frau. Leider konnten in der Realität damals nur wenige Frauen dieses Rollenbild leben. Insbesondere im ländlichen Bereich hatten Frauen es schwer, aus der traditionellen Rolle auszubrechen, weil ihnen entweder finanzielle Mittel oder der notwendige Einfluss fehlte.
In der Zeit des Nationalsozialismus verstärkte sich das traditionelle Mutterbild wieder. Es herrschte ein regelrechter Mutterkult, der ab 1938 in der Verleihung des Mutterkreuzes gipfelte. Frauen, die den Maßstäben der nationalsozialistischen Propaganda entsprachen, wurden in ihrer biologischen Funktion gefeiert und zurück in die Rolle der Mutter und Hausfrau gedrängt. Der Arbeitsmarkt stand ihnen nicht mehr offen. Nur noch die angeblich “typisch weiblichen” Tätigkeiten wie Krankenschwester oder Sekretärin sollten von Frauen ausgeübt werden, sofern Vater oder Ehemann ihre Einwilligung gaben. Erst nach Beginn des 2. Weltkriegs war diese strikte Trennung nicht mehr realisierbar, da nun die Frauen für den Familienunterhalt aufkommen mussten und die Rolle als Hauptverdienerin einnahmen. Dieselben Frauen, denen jahrelang die Rolle als Hausfrau angepriesen worden war, wurden schlagartig zu unentbehrlichen Arbeitskräften in Rüstungsfabriken angelernt, während ihre Männer im Krieg kämpften. Sie leisteten dort Schwerstarbeit für nur etwa die Hälfte des Männergehalts. Ihre jüngeren Kinder kamen in Tagespflegeeinrichtungen und Kindergärten, die älteren Jungen an die Front.
In der Nachkriegszeit und dem wiederkehrenden Wohlstand breitete sich das bürgerliche Familienmodell wieder flächendeckend aus und wurde auch in Arbeiterfamilien, in denen das Gehalt des Vaters für den Familienunterhalt ausreichte, zunehmend praktiziert. Zugleich wurde die Erziehung emotional offener und kindzentrierter, was zu einer Veränderung der Rolle der Mutter führte. In den 1950er und 1960er Jahren erlebte das bürgerliche Mutterbild sein Revival, sodass die meisten Frauen nach der Geburt eines Kindes zu Hause blieben und Haushalt sowie Erziehung übernahmen.
Durch die modernen feministischen Frauenbewegungen in den 60er und 70er Jahren, die die geschlechterspezifische Diskriminierung anprangerten, wurde die vorherrschende Rollenverteilung erneut in Frage gestellt. Vertreterinnen der verschiedenen Gruppierungen kritisierten offen die Abhängigkeit nicht erwerbstätiger Mütter von ihren Ehemännern sowie die Lohnunterschiede zwischen berufstätigen Frauen und Männer. Auch zeigten sie die gesellschaftliche Benachteiligung von Müttern bis hin zur sozialen Isolation durch das Muttersein an. Grund zum Unmut lieferte zudem das bürgerliche Mutterideal, welches Mutterschaft als die Essenz von Weiblichkeit propagierte. Selbstverwirklichung sah für die meisten Frauen schon damals anders aus und konnte in den bestehenden Strukturen kaum funktionieren. Eine Änderung des Systems musste her, für das Aktivistinnen in Massen auf die Straße gingen und demonstrieren, aber auch gezielt politisch aktiv wurden.
Als Resultat der Bewegung wurde ab den 1970er Jahren der weiblichen Ausbildung und Berufstätigkeit eine neue Bedeutung beigemessen. Die emanzipierte Frau trachtete nun nach einer guten Schul- und Berufsbildung, war voll erwerbstätig und karriereorientiert. Eine Ehe wurde von einer emanzipierten Frau nur eingegangen, wenn eine partnerschaftliche Beziehung und eine gerechte Aufteilung der Hausarbeit und ggf. Kindererziehung zu erwarten war. Dadurch stieg die Anzahl berufstätiger Mütter in der westlichen Welt deutlich an und die durchschnittliche Wochenarbeitszeit wurde kontinuierlich länger. Die Reform des Ehe- und Familienrechts im Juli 1977 untermauerte diese Entwicklung. Darin nahm das BGB vom Leitbild der Hausfrauenehe Abstand und verzichtete auf Vorgaben zum Ehemodell. Die zuvor strengen Gesetze für berufstätige Ehefrauen wurden abgeschafft. Nun durfte der Mann nicht mehr über die Erwerbstätigkeit seiner Frau entscheiden und Paare sollten sich gemeinsam einigen, wie die Arbeit im Haushalt aufgeteilt wird. Auch führte das Rollenbild dazu, dass viele Frauen kinderlos und unverheiratet blieben und sich voll auf den Beruf, statt auf das Gebären und Erziehen von Kindern konzentrierten.
Uns Frauen haben die feministischen Bewegungen einen Bärendienst erwiesen. Wir haben nun die Wahl zwischen verschiedenen Lebensentwürfen und müssen weder das Gesetz noch die gesellschaftliche Ächtung fürchten. Neben dem traditionellen Mutterideal und seinem Gegenbild der erwerbstätigen Frau ist unser Alltag dabei zumeist ein Versuch, beide Konzepte miteinander zu vereinen. Ein gerne von Medien aufgegriffenes Beispiel, wie das angeblichen gelingen kann, ist das Leitbild der Supermutter. Dieses kam in den 90er Jahren auf und wurde von der Frauenforscherin Sharon Hays wie folgt charakterisiert: “Mühelos schafft sie den Spagat zwischen Heim und Arbeit. Diese Mutter kann mit der einen Hand einen Kinderwagen schieben und mit der anderen die Aktentasche tragen. Sie ist immer gut frisiert, ihre Strumpfhosen haben nie Laufmaschen, ihr Kostüm ist stets frei von Knitterfalten, und ihr Heim ist natürlich blitzsauber. Ihre Kinder sind makellos: Sie haben gute Manieren, sind aber nicht passiv, sondern putzmunter und strotzen vor Selbstbewusstsein”. Trotz ihrer Vollerwerbstätigkeit bringt die überzeichnet beschriebene Supermutter einen enormen Aufwand an Zeit und Energie für die Betreuung und Erziehung ihrer Kinder auf. Realitätsferner geht es kaum.
Daneben existiert das sogenannte Drei-Phasen-Modell, nachdem heute viele Mütter leben, ohne diesen Lebensentwurf als solchen zu betiteln. Es unterteilt das berufliche Leben einer Frau in drei Phasen, beginnend mit einer guten Ausbildung und ambitionierten Berufstätigkeit der Frau bis zur Geburt des ersten Kindes, gefolgt von einer Zeit, in der der Fokus der Frau auf der Betreuung und Erziehung der Kinder liegt. Sobald dies nicht mehr nötig ist bzw. anderweitig gewährleistet werden kann, sei es durch die Volljährigkeit der Kinder oder ab dem Moment, wenn ein Betreuungsplatz zur Verfügung steht, kehrt die Mutter in den Beruf zurück, wo sie nach Herzenslust weiter ihre Karriere verfolgen kann. Klingt selbstbestimmt und einfach. Tatsächlich malen sich viele Frauen in der westlichen Welt ihr Leben genauso aus. Eine Phase nach der anderen mit vollem Fokus auf die derzeitige Lebenssituation. Auch ich habe diesen Plan verfolgt, als ich jung war: Erst studieren, dann im Beruf etablieren und eines Tages eine Familie gründen. Zeitweise beruflich zurückfahren, um meinen Nachkömmlingen einen guten Start ins Leben zu ermöglichen, dann Schwung holen und wieder voll beruflich durchstarten. Ja, das war mein Plan. Und dann wurde ich Mutter. So trivial, wie das Drei-Phasen-Modell die Lebensrealität einer Mutter darstellt, ist sie in vielen Familien nämlich nicht. Systematische Fehler, wie mangelnde Betreuungsoptionen, besondere familiäre Gegebenheiten und gesellschaftliche Erwartungen, gerade für gut ausgebildete Mütter, legen uns schwere Steine in den Weg. Aber dazu später mehr.
Fassen wir die unterschiedlichen Lebensszenarien aus den vergangenen Jahrhunderten zusammen, so wird klar, dass Frauen mit Kindern die meiste Zeit entweder Arbeiterin oder Hausfrau und Mutter waren. Selten beides. Wenn eine Frau arbeiten ging, spielte Erziehung zumeist kaum eine Rolle. Ferner wurden Kinder sogar als Hilfen und zusätzliche Arbeitskräfte eingesetzt, um das Leben zu erleichtern. War die Frau Zuhause, lag der Fokus voll auf Heim und Familie, sodass zumindest der mit einer Berufstätigkeit einhergehende Stress wegfiel. Auch, wenn es immer ein wenig von der Perspektive abhängt und jede Zeit zweifelsohne ihre ganz eigenen Herausforderungen und Tragödien hatte, zeigt sich, dass Mütter heute überaus belastet sind. Nicht nur sollen wir eine hingebungsvolle, aufmerksame Mutter sein, die immer für ihre Kinder da ist. Es wird auch erwartet, dass wir eine erfolgreiche Berufslaufbahn vorweisen können, so als ob wir keine Kinder hätten, die uns davon ablenken. Gleichermaßen ist die Erwerbstätigkeit oftmals keine freiwillige Entscheidung mehr, da die Existenz der Familie nur durch zwei Einkommen gesichert werden kann. Die oftmals fehlende Unterstützung durch eine Großfamilie tut ihr Übriges für einen anstrengenden Alltag und chronischen Stress.Wir haben daher alles Recht uns auch mal zu beklagen und es ist auch nicht absurd zu sagen “Früher war es leichter.” Manches war es.